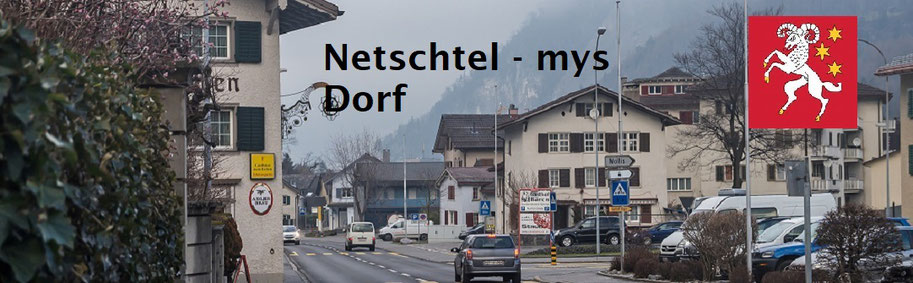Auswanderer nach Russland
Text von Fritz Weber, Zusammenfassung durch KI

Maximilian-Hospital am Wosnesenskij-Prospekt 9 in St. Petersburg, um 1900
Der Text porträtiert drei Russlandschweizer aus Netstal (Kanton Glarus), die im 19. und frühen 20. Jahrhundert im Zarenreich lebten und arbeiteten: Theodor Melchiorowitsch Kubli, Tobias Leuzinger und Arthur Melchiorowitsch Leuzinger.
Theodor Melchiorowitsch Kubli (1856–nach 1928)
Der aus einer ausgewanderten Glarner Familie stammende Kubli wurde 1856 in Avinurme (Estland) geboren. Nach dem
Medizinstudium an der Universität Dorpat spezialisierte er sich auf Augenheilkunde. Ab 1884 wirkte er als Augenarzt am renommierten Maximilian-Hospital in St. Petersburg und veröffentlichte
zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten.
Er war Mitbegründer der Russischen Ophthalmologischen Gesellschaft (1885) und wurde von Zar Nikolaus II. zum «Wirklichen Staatsrat» ernannt, was ihm den erblichen Adelsstand verlieh. Nach der
Revolution 1917 blieb er in Russland und lebte zuletzt (1928) in Leningrad.
Tobias Leuzinger (1857–1935)
Geboren in Netstal, zog Leuzinger 1874 nach Russland, wo er zunächst in einer Schnapsbrennerei arbeitete. In Tiflis
(Tbilissi) wurde er später leitender Mitarbeiter des bekannten georgischen Cognac-Fabrikanten David Saradschew (Sarajishvili) und gründete Zweigstellen in mehreren Städten des
Zarenreichs.
Nach über 40 Jahren erfolgreicher Tätigkeit verlor er infolge der Revolution 1917 sein gesamtes Vermögen und wurde kurzzeitig zur Roten Armee eingezogen. 1921 kehrte er mittellos in die Schweiz
zurück und starb 1935 in Glarus.
Arthur Melchiorowitsch Leuzinger (1871–1938)
Arthur, Sohn des aus Glarus stammenden Molkereipächters Melchior Leuzinger, wurde in Livland (heute Estland) geboren. Er
studierte an der Kunstakademie St. Petersburg und arbeitete dort als Lehrer und Künstler. Trotz der Revolution blieb er in Russland.
In den 1930er-Jahren fiel er den stalinistischen Säuberungen zum Opfer: 1937 verhaftet, wurde er Anfang 1938 wegen angeblichen Geheimnisverrats zum Tode verurteilt und kurz darauf
erschossen.
Gesamtfazit
Die drei Biografien zeigen exemplarisch die Schicksale von Schweizern, die im Zarenreich Karriere machten – als Wissenschaftler, Unternehmer und Künstler – und deren Lebenswege durch die russische Revolution und die politischen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts tragisch oder abrupt endeten.